Dialoge gehören zu den kraftvollsten Werkzeugen in der erzählenden Literatur. Sie können eine Handlung vorantreiben, Figuren charakterisieren und Spannung erzeugen – oder das Gegenteil bewirken, wenn sie hölzern, überladen oder unnatürlich wirken.
Ein gut geschriebener Dialog lässt Leserinnen und Leser vergessen, dass sie gerade gedruckte Worte sehen – er klingt so, als würden sie einer echten Unterhaltung lauschen.
In diesem ersten Teil schauen wir uns die Grundlagen gelungener Dialoggestaltung an und werfen einen Blick auf typische Fehler, die man vermeiden sollte.
1. Die Funktionen eines Dialogs
Ein Dialog kann mehr, als nur Figuren Worte in den Mund legen. Er erfüllt in Geschichten oft mehrere Funktionen gleichzeitig:
- Handlung vorantreiben: Ein Dialog sollte selten nur „Smalltalk“ sein, sondern den Plot in Bewegung setzen.
- Charakterisierung: Sprache, Ausdrucksweise und Themenwahl verraten viel über eine Figur.
- Spannung erzeugen: Konflikte, Geheimnisse oder Andeutungen können im Dialog subtil platziert werden.
- Exposition einbinden: Informationen können durch Gespräche natürlicher wirken als in langen Beschreibungen – sofern sie organisch eingebettet sind.
2. Gesprochene Sprache vs. literarischer Dialog
Echter Alltagssprech und literarischer Dialog sind nicht identisch. Wer jede „Äh“-Pause, jedes Stocken und alle Wiederholungen mitschreibt, riskiert, die Lesbarkeit zu opfern. Umgekehrt wirkt ein zu polierter Dialog unnatürlich.
- Tipp: Realismus einfangen, aber straffen. Unwichtiges weglassen, ohne den Rhythmus zu zerstören.
- Beispiel:
- Alltag: „Ähm, also, ich dachte halt, dass wir, äh, vielleicht ins Kino… oder so…“
- Literatur: „Ich dachte, wir könnten ins Kino gehen.“ – Ein leichtes Zögern in der Gestik kann den Rest zeigen.
3. Häufige Fehler in Dialogen
a) Infodumping
Wenn Figuren sich Dinge erzählen, die sie eigentlich schon wissen, wirkt es konstruiert.
Beispiel: „Wie du weißt, bist du seit drei Jahren mein Nachbar.“ – Das würde im echten Leben niemand sagen.
b) Zu viele Füllwörter
Echte Gespräche sind voll von „ähm“, „also“ und „irgendwie“. In Maßen kann das eine Figur charakterisieren, im Übermaß bremst es den Lesefluss.
c) Unnatürliche Formulierungen
Dialoge dürfen nicht wie geschriebene Aufsätze klingen. Wenn ein Satz perfekt ausformuliert ist, aber niemand so sprechen würde, passt er nicht.
d) Informationsstau
Wenn eine Figur in einem Monolog alles erklärt, verliert der Dialog seine Lebendigkeit. Informationen besser auf mehrere Gesprächspassagen verteilen.
4. Exposition geschickt einbauen
Der Leser braucht oft Hintergrundinformationen, aber die sollten organisch wirken.
- Besser: Figuren sprechen über ein Problem, weil es für sie relevant ist – nicht, um den Leser zu belehren.
- Beispiel: Statt „Wie du weißt, war das alte Haus seit 1920 verlassen“ lieber: „Ich hätte nie gedacht, dass jemand in dieses alte Haus zieht. Seit 1920 stand es leer!“
Fazit
Gute Dialoge wirken mühelos, sind aber das Ergebnis bewusster Gestaltung. Sie verbinden Realismus mit Lesbarkeit, transportieren Charakter und treiben die Handlung voran. Wer die typischen Fehler kennt und vermeidet, schafft Dialoge, die Leser fesseln und die Figuren zum Leben erwecken.
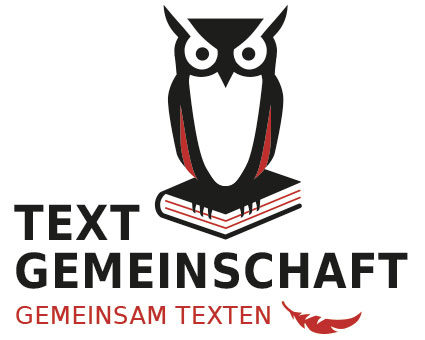
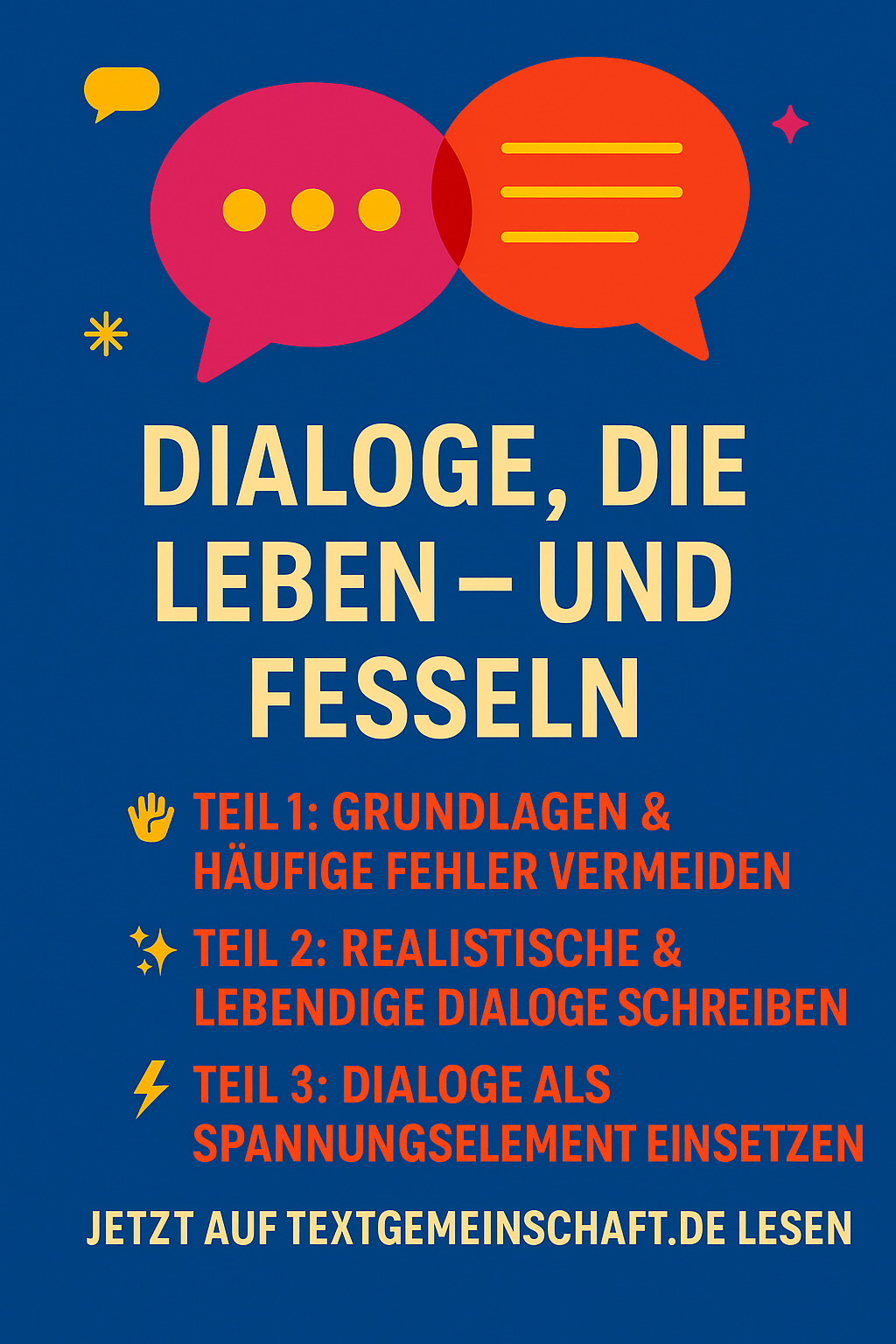
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.